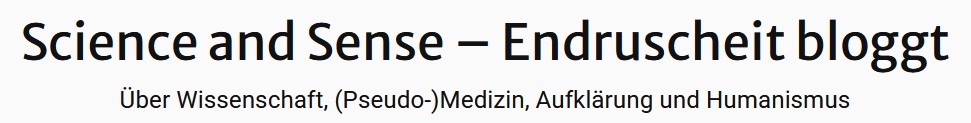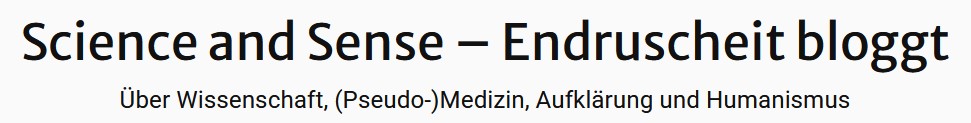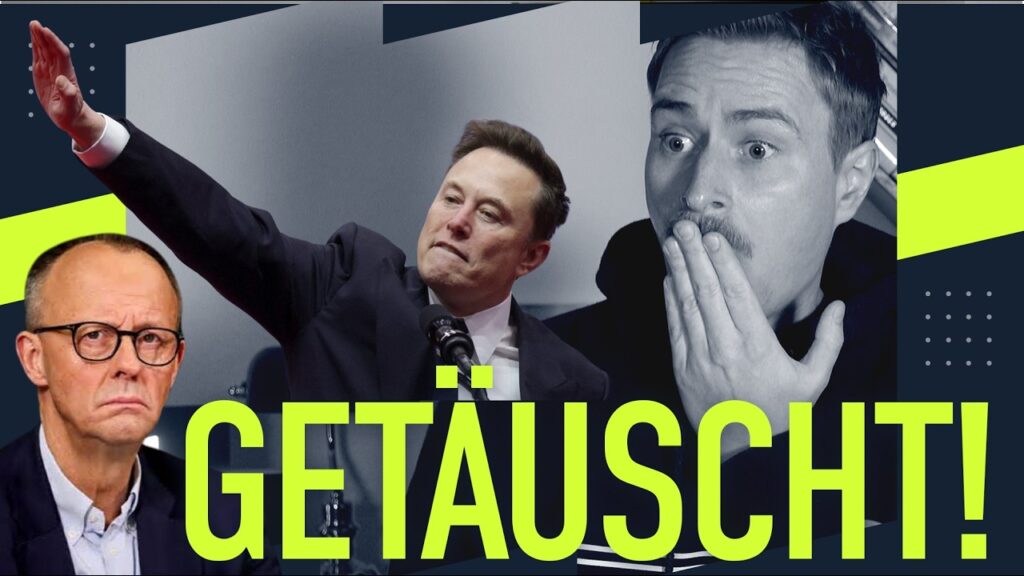14. Februar 2025
von Manfred Körkel
47 Kommentare
Es folgt nur eine Zusammenfassung. Die vollständige Analyse mit Quellenangaben findet sich auf scientifictemper.org. Aufgrund weniger Anmerkungen wurde dieser Artikel am 28.2.2025 an drei Stellen schlüssiger formuliert, was aber keinen Einfluss auf die Gesamtaussage hat.
Paul Kurtz, Philosoph und Gründer des Committee for Skeptical Inquiry (CSI), meinte in seinen späten Jahren, dass sich diese Tätigkeit seit der Gründung 1976 verschoben habe. Ursprünglich habe es sich um pseudowissenschaftliche, paranormale Behauptungen gehandelt. Heute kämen jedoch viele der Angriffe auf die Integrität und Unabhängigkeit der Wissenschaft von politisch-theologisch-moralischen Doktrinen.
2023 gab es Umwälzungen in der deutschen Skeptikerbewegung. Zentral war darin ein Streit, ob die postmodern beeinflussten Critical Studies aus den Sozialwissenschaften auch ein legitimes Thema sein können. Noch 2019 hatte Kendrick Frazier vom CSI die Universalität skeptischer Untersuchungen betont. Darüber herrschte in der deutschen Skeptikerszene jedoch keine Einigkeit mehr. In der Folge distanzierten sich Mitglieder von der deutschen Skeptikerorganisation GWUP und wollten diesen Ansatz nicht mehr unterstützen.
Bisher (Januar 2025) ist noch kein Grundsatzpapier bekannt, das die Position der Kritiker aussagekräftig von der der GWUP abgrenzt. Um dem nachzugehen, bietet es sich daher an, in verwandten Textbeiträgen von Kritikern analytisch nach relevanten Auffassungen, Denkweisen oder Haltungen zu suchen.
Einer dieser Kritiker ist der mehrfach ausgezeichnete Wissenschaftspublizist Florian Aigner. Im Jahr 2024 publizierte er zwei Meinungsessays mit den Titeln “Die Selbstüberschätzung der Naturwissenschaft” und “Aber eine Studie hat gesagt”. Darin dreht es sich um das Verhältnis zwischen Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften und um die Rolle der Empirie in den Sozialwissenschaften. Diese Texte wurden analysiert, um Hinweise auf die Positionierung zu erhalten.
Leider zeigten sich bei der Analyse der Texte einige Mängel. So sind sie leider durchsetzt von Ungenauigkeiten, Selektionsbias, Framing, Kategorienfehlern und Strohmannargumenten.
Die Ausführungen von Florian Aigner zu geschlechtsspezifischen Präferenzen und zum Gleichberechtigungsparadox wurden genauer betrachtet und auch die Fachliteratur dazu konsultiert. Die von Aigner monierte Unreflektiertheit ließ sich nicht feststellen: Mit unterschiedlichen Methoden wird empirisch untersucht, ob es angeborene Präferenzen gibt oder ob alles sozial konstruiert ist. Dass normative Stereotype allein unterschiedliches Verhalten erklären, ist angesichts der Ergebnisse wenig plausibel. Florian Aigner scheint auch dem Irrtum zu unterliegen, dass verwirklichte Gleichberechtigung zwingend faktische Gleichheit implizieren muss.
Das macht es nicht einfacher, herauszufinden, wofür der Autor denn im positiven Sinne steht. Es ließ sich jedoch eine Tendenz in den Texten feststellen, nämlich eine Betonung des Moralismus gegenüber der Empirie, auch wenn es sich nicht um Normen, sondern um Tatsachen handelt. Wenn die empirischen Sozialwissenschaften jede Meinung belegen können, sind sie de facto desavouiert. Um ohne Bezug auf Tatsachenfeststellungen dennoch zu entscheiden, ob eine “Meinung gefährlicher Unsinn” ist oder nicht, bleibt dann nur der Rückgriff auf eine moralische Doktrin. Die Annahme, dass es in den Texten gar nicht um Wissenschaft geht, sondern um eine zeitgeistige Tugendsignalisierung, erscheint daher plausibel.