Bereits vor einer Woche veröffentlichte Udo Endruscheit auf seinem Blog einen Artikel, der an den Beitrag zur Standortbestimmung der GWUP anschließt und noch weiterführende Gedanken dazu aufzeigt.
Udo schließt sich der Aussage der Standortbestimmung an:
Insgesamt verdeutlicht der Beitrag die Notwendigkeit, wissenschaftliche Methoden als Grundlage für objektive Wahrheitsfindung zu fördern und gleichzeitig kritisch gegenüber subjektiven oder ideologisch geprägten Ansätzen zu bleiben. Die Diskussion in den Kommentaren zeigt, dass es weiterhin wichtig ist, Aufklärungsarbeit zu leisten und die Prinzipien der Wissenschaft verständlich zu kommunizieren.
Als Kritikpunkt in den Kommentaren konnte er erkennen:
Vielen ist offenbar der „Erkenntnispfad“ zu schmal. Aber ist es nicht eigentlich das Ergebnis von mehr als 2000 Jahren Ringens um eine Antwort auf die Frage „Was können wir wissen?“ […] dass wir nur in einem solchen schmalen Pfad vorankommen können?
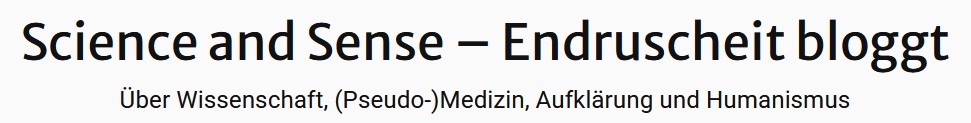
An diesem komme man nicht vorbei:
Wissenschaft hat sich gerade nicht durch Offenheit für Beliebigkeit weiterentwickelt, sondern durch die konsequente Einhaltung strenger methodischer Prinzipien. Anders gesagt: Die moderne Wissenschaft ist gerade deshalb erfolgreich, weil sie sich einen strengen methodischen Rahmen gibt.
Man könnte also sagen: Der „Erkenntnispfad“ ist nicht deshalb schmal, weil man andere Denkweisen aus Bosheit oder Überheblichkeit ausschließt, sondern weil die Anforderungen an belastbare Erkenntnis so hoch sind. […] Wer diesen Rahmen verlassen will, sollte sich fragen, ob er Wissenschaft tatsächlich verstanden hat oder ob er sich unbewusst von den postmodernen Tendenzen der Beliebigkeit beeinflussen lässt.
Deshalb weite die GWUP ihren skeptischen Blick auch auf Bestrebungen aus, die dieser Beliebigkeit Vorschub leisten:
Die GWUP stärkt damit ihre Positionierung als metatheoretische skeptische Organisation: Sie legt sich nicht nur mit falschen Behauptungen an, sondern auch mit ganzen Erkenntniswegen, die Wissenschaftlichkeit für sich und ihre Hervorbringungen beanspruchen, aber den methodischen Standards nicht genügen. Das ist m.E. eine notwendige Erweiterung des skeptischen Ansatzes, weil viele heutige Debatten sich nicht mehr nur um „falsche Fakten“, sondern um die grundlegenden Maßstäbe für Wahrheit und Erkenntnis drehen.
Sein Fazit:
Ich glaube, dass eine solche Positionierung für skeptische Organisationen wie die GWUP langfristig notwendig ist. […] Es geht nicht nur darum, offensichtlichen Unsinn zu entlarven, sondern auch um das „Aufräumen“ in wissenschaftsnahen Debatten – dort, wo Begriffe und Methoden missbraucht werden, um Beliebigkeit als Wissenschaft zu verkaufen und damit in den öffentlichen Diskurs einzusickern.
Den kompletten Artikel findest Du auf Udos Blog.
Zum Thema:
Artikel: Hochmütige Naturwissenschaft und propagandistische Empirik?, GWUP-Blog vom 14.02.2025
Hinweis:
- Wenn ihr noch nicht im Skeptischen Netzwerk angemeldet seid, möchten wir euch herzlich dazu einladen. Dort finden GWUP-Mitglieder und Interessierte eine Plattform für Diskussionen und Austausch rund um skeptische Themen: https://skeptisches-netzwerk.de/.
- Falls ihr Ideen, Anregungen oder Empfehlungen habt bzw. selbst ein Gastkapitel für den GWUP-Blog schreiben möchtet, kontaktiert uns unter: blog@gwup.org.
2. März 2025 um 10:29
Hier meine persönlichen Bookmarks zu dem GWUP Konflikt. Die Gegenseite hat leider meist nur Videos oder Tweets oder von einigen Personen erschreckend flache und unreflektierte Blogbeiträge veröffentlicht, die ich hier nicht reproduzieren will.
September 2022: Gastbeitrag – Zynische Theorien: Wie Identitätsideologie die Geistes- und Sozialwissenschaften beschädigt https://blog.gwup.net/2022/09/05/gastbeitrag-zynische-theorien-wie-identitaetsideologie-die-geistes-und-sozialwissenschaften-beschaedigt/ Dieser Gastbeitrag untersucht, wie Identitätsideologien die Geistes- und Sozialwissenschaften beeinflussen und beschädigen. Gerade die Kommentare sind spannend.
2023: Martin Mahner – Warum die sog. „Critical Studies“ unter Pseudowissenschaftsverdacht stehen https://miz-online.de/warum-die-sog-critical-studies-unter-pseudowissenschaftsverdacht-stehen/ Martin Mahner erklärt, warum die sogenannten „Critical Studies“ als pseudowissenschaftlich angesehen werden und welche Auswirkungen dies auf die wissenschaftliche Integrität hat.
Mai 2023: Gunnar Schedel – Putsch in der GWUP – ein fataler Richtungswechsel steht bevor https://hpd.de/artikel/putsch-gwup-verein-rueckt-nach-rechts-21301 Gunnar Schedel beschreibt die überraschende Wahl von Holm Hümmler zum Vorsitzenden der GWUP und den damit getätigten Tabu-Bruch in der GWUP. Ein klassischer Phyrrussieg, wie sich später herausstellt.
Mai 2023: Rainer Rosenzweig – Führende Mitglieder der GWUP kritisieren manipulative Taktiken bei Vorstandswahl https://hpd.de/artikel/fuehrende-mitglieder-gwup-kritisieren-manipulative-taktiken-vorstandswahl-21302
Mai 2023: Florian Schwarz – Wokeness ist letztlich eine anti-wissenschaftliche Weltanschauung https://hpd.de/artikel/wokeness-letztlich-anti-wissenschaftliche-weltanschauung-21314
November 2023: Florian Schwarz – Wokeness: Ein Freibrief für Critical Studies? https://hpd.de/artikel/wokeness-freibrief-fuer-critical-studies-21719 Florian Schwarz diskutiert, ob Wokeness als Freibrief für die Verbreitung von Critical Studies dient und welche Auswirkungen dies auf die Wissenschaft hat.
November/Dezember 2023: Stuart Vyse – Shakeup among German Skeptics https://skepticalinquirer.org/2023/10/shakeup-among-german-skeptics/ S
2023: Nikil Mukerji – Die Pseudowissenschaftlichkeit der Critical Studies – der Fall Robin DiAngelo https://miz-online.de/die-pseudowissenschaftlichkeit-der-critical-studies-der-fall-robin-diangelo/ Nikil Mukerji untersucht die Pseudowissenschaftlichkeit der Critical Studies anhand des Falls Robin DiAngelo.
2023: Andreas Edmüller – Zur Matauranga Maori Debatte in der Skeptikerszene https://blog.projekt-philosophie.de/woke-phaenomen/das-woke-phaenomen-zur-debatte-um-matauranga-maori/ Andreas Edmüller diskutiert die Matauranga Maori Debatte in der Skeptikerszene und deren Auswirkungen auf die wissenschaftliche Integrität.
Februar 2024: Johannes Zeller – The German Dilemma: A Skeptic Schism with Global Implications? https://skepticalinquirer.org/exclusive/the-german-dilemma-a-skeptic-schism-with-global-implications/ Johannes Zeller analysiert die Führungskrise innerhalb der GWUP und die globalen Auswirkungen dieser Spaltung.
April 2024: Johannes Zeller – The German Dilemma Continues: Skepticism in the Face of Ideological Conflict https://skepticalinquirer.org/exclusive/the-german-dilemma-continues-skepticism-in-the-face-of-ideological-conflict/ Johannes Zeller beleuchtet die fortlaufenden Konflikte innerhalb der GWUP und die Herausforderungen für die wissenschaftliche Skepsis.
April 2024: Schulte von Drach, M.C. – Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften: Alles „woke“? Wie sich ein Verein für kritisches Denken selbst zerlegt https://www.sueddeutsche.de/wissen/gwup-parawissenschaften-woke-1.6541158?reduced=true Schulte von Drach beschreibt, wie sich die GWUP durch interne Konflikte und ideologische Auseinandersetzungen selbst zerlegt.
9. Mai 2024: Holger Marcks – Memo: Das skeptische Spektakel – Anmerkungen zum Konflikt um »Wokeness https://mit-cks.net/memo-das-skeptische-spektakel/ Holger Marcks kommentiert den Konflikt um Wokeness innerhalb der GWUP und die daraus resultierenden Spannungen.
13. Mai 2024: Gunnar Schedel – Der Richtungsstreit bei den deutschen Skeptikern ist erstmal entschieden https://hpd.de/artikel/richtungsstreit-den-deutschen-skeptikern-erstmal-entschieden-22176 Gunnar Schedel berichtet über die vorläufige Entscheidung im Richtungsstreit bei den deutschen Skeptikern. Team Holm hat verloren, die ideologische Übernahme der GWUP ist gescheitert.
13. Mai 2024: Cornelius Courts – Dawn of the GWUP. Die Schlacht zu Augsburg und eine neue Hoffnung https://scienceblogs.de/bloodnacid/2024/05/13/dawn-of-the-gwup-die-schlacht-bei-augsburg-und-eine-neue-hoffnung/?all=1%20%E2%80%A6 Cornelius Courts beschreibt die Schlacht bei Augsburg und die daraus resultierende neue Hoffnung für die GWUP.
30. Mai 2024: Johannes Zeller – The German Dilemma Update: New GWUP Board Pledges Return to Critical Inquiry https://skepticalinquirer.org/exclusive/the-german-dilemma-update-new-gwup-board-pledges-return-to-critical-inquiry/ Johannes Zeller berichtet über das neue GWUP-Vorstandsversprechen, zur kritischen Untersuchung zurückzukehren.
Nikil Mukerji via Michael Shermer: – Pseudo-Skepticism https://michaelshermer.substack.com/p/pseudo-skepticism
2. März 2025 um 12:47
Ja!
Ich bin kein Philosoph, aber ich kann spontan ein gutes Beispiel liefern, daß, intuitiv betrachtet, die Überlegungen von Udo Endruscheit völlig richtig sind: Ich habe letztens blöderweise eine (schon etwas ältere) Bachelorarbeit im Fach Soziale Arbeit zum Spaß gelesen. Dummerweise habe ich verstanden, was drin stand. 90% Theoriebildung, garniert mit den üblichen Buzzwords, ohne die die Dozenten der Studentin wahrscheinlich die Arbeit nicht abgenommen hätten, dabei vorgetragen im Tone der moralischen Überlegenheit und mit vollkommener Unreflektiertheit (außer, daß die Autorin offenbar nicht zur zu betreuenden Zielgruppe gehörte, und dies zunächst einmal als problematisch ansah).
Quintessenz ohne den ideologischen Überbau: Ja, Angehörige der Gruppe, um die es ging, können Experten in eigener Sache sein. Das sollte man anerkennen und fördern. Ansonsten möge man nicht nur auf die individuellen Probleme der Gruppenangehörigen eingehen, sondern auch versuchen, das Los der Gruppe insgesamt zu bessern und die gesellschaftliche Akzeptanz erhöhen. Dabei soll man sich nicht wie ein Arschloch gegenüber den Klienten verhalten. Und man darf die Klienten auch dann unterstützen, wenn man nicht ihrer Gruppe angehört.
Das sind dann so die Erfolge der modernen Wissenschaft ohne strenge Methodik.
2. März 2025 um 15:15
@Nadine: Das ist natürlich schon ein interessantes Potpourri. Teilweise richtig gut durchdachte Artikel, teilweise aber auch welche mit geradezu absurden Inhalten (bei denen man allerdings entschuldigend hinzufügen kann, dass es sich zumindest teilweise um wenig durchdachte Schnellschüsse handelte).
2. März 2025 um 17:05
Wurde heute im Skeptischen Netzwerk gepostet: How Behavioral Science Lost its Way And How It Can Recover
https://www.skeptic.com/article/behavioral-science-dei-critique-scientific-principles/
„Over the past decade behavioral science, particularly psychology, has come
under fire from critics for being fixated on progressive political ideology, most
notably Diversity, Equity, and Inclusion (DEI). The critics’ evidence is,
unfortunately, quite strong. For example, a recent volume, Ideological and Political Bias in
Psychology, recounts many incidents of scholarly censorship and personal attacks that a decade ago
might have only been conceivable as satire.“
We believe that many problems plaguing contemporary behavioral science, especially for issues touching upon DEI, can best be understood, at their root, as a failure to adhere to basic scientific principles.“
Die Autoren des Artikels empfehlen drei grundlegende wissenschaftliche Prinzipien,
um die Verhaltenswissenschaften wieder auf den richtigen Weg zu bringen:
1. Priorisierung objektiver Daten über persönliche Erfahrungen: Wissenschaft sollte sich auf objektive,
messbare Daten stützen, anstatt auf subjektive, persönliche Erlebnisse
2. Präzise Messungen: Genauigkeit und Präzision in der Datenerhebung sind entscheidend, um valide und
zuverlässige Ergebnisse zu erzielen.
3. Unterscheidung zwischen Korrelation und Kausalität: Es ist wichtig, klar zwischen Korrelation (Zusammenhang) und
Kausalität (Ursache-Wirkung) zu unterscheiden, um Fehlinterpretationen zu vermeiden.
2. März 2025 um 17:33
Ich danke Nadine für die Zusammenstellung! Des weiteren empfehle ich, die Artikel zu lesen. Und dann kann ich auch noch etwas eigenes beisteuern (der Text wurde von 2 Biologiefachleuten gegengelesen). Holm Hümmler und Fabian Deister über biologisches Geschlecht: https://wiki.beginnersmind.de/index.php?title=Feodors_Wiki
2. März 2025 um 19:26
Auf dem hier propagierten schmalen Erkenntnispfad landet man schnell in der Borniertheit. Die meisten unserer Probleme lassen sich vernünftig diskutieren und doch nicht objektiv lösen. Das sehen wir an den ganz großen Fragen mit den aktuellen Brennpunkten Ukraine und Gaza. Aber schon die Frage KKW ja oder nein ist allein mit den an den Naturwissenschaften geschärften Methode nicht zugänglich. In dem Zusammenhang komme ich immer wieder auf die Rolle des subjektiven Risikos zu sprechen. Wie einen die Faktengläubigkeit narren kann, sehen wir beispielsweise an der Ifo Pressemeldung vom 18.02.2025: »Die Annahme, dass Ausländer oder Schutzsuchende eine höhere Kriminalitätsneigung besitzen als demografisch vergleichbare Einheimische, ist nicht haltbar.« Diese Meldung, die auch Ricarda Lang auf X übernommen hat, zähle ich zu den »alternativen Fakten« (Kellyanne Conway).
https://www2.hs-fulda.de/~grams/hoppla/wordpress/?p=3923
3. März 2025 um 09:42
Seit einem halben Jahrhundert beschäftige ich mich mit kognitiven Täuschungen, die ich dann »Denkfallen« nannte (Denkfallen und Programmierfehler. Springer Verlag Heidelberg, 1990). Diese Tätigkeit genügt nicht den strengen (natur)wissenschaftlichen Ansprüchen. »Postmoderne Beliebigkeit« ist es aber auch nicht. Für den Skeptiker jedenfalls sind solche Betrachtungsweisen zentral.
3. März 2025 um 12:04
Udo schreibt: „Der Unterschied zum „konstruktivistischen Wissen“ besteht darin, dass durch Methodik, darunter rigorose Fehler- und Irrtumskontrollen, wissenschaftlichen Erkenntnissen zunehmend ein Grad von Gewissheit zuwächst, der uns in die Nähe der „Wahrheit“ (Wirklichkeit) führt.“
Und da geht es jetzt schon los.
Philipp Hübl z.B. differenziert dahingehend, „Die Wahrheit“ gäbe es nicht, sondern nur wahre Aussagen und Überzeugungen. Und von Annähern könne man ohnehin nur sprechen, wenn man schon wisse, wo sich die Wahrheit befindet.
Was also ist jetzt mit Hans Albert und der Nähe zur Wahrheit?
Darüber habe ich schon mal auf dem hpd diskutiert.
Mein Kontrahent rieb sich an einem Satz in einer gbs-Broschüre: „Wenn wir unsere Fehler schrittweise korrigieren, kommen wir der Wahrheit nämlich jedes Mal ein bisschen näher“.
Selbes Argument wie Hübl: Wie will man denn die Wahrheitsnähe messen / bestimmen?
Noch fuchsiger wurde er bei angesichts dieser Würdigung von Hans Albert durch die Uni Mannheim: „Als Vorreiter und Vertreter des Kritischen Rationalismus steht Hans Albert für eine wissenschaftliche Denkweise, die sich durch die ständige kritische und empirische Prüfung von Theorien auszeichnet, um eine Annäherung an die Wahrheit zu erlangen.“
Hans Albert selber bestreite „eine solche (valide, irgendwie beweisbare) Messbarkeit einer Wahrheitsnähe übrigens vehement“.
Jetzt wurde es interessant, denn er verwies auf ein bekanntes Interview, in dem Albert sagte: „Nichts kann als vollkommen wahr erkannt und mit absoluter Gewissheit gewusst werden. Aber deshalb die Idee einer möglicherweise (extramental) existierenden Wahrheit, der man näher kommen kann, ohne dies aber jemals mit letzter Gewissheit erkennen und wissen zu können, aufzugeben, kommt einer geöffneten „Schranke“ gleich, die dazu auffordert, den Weg des Relativismus und/oder Subjektivismus zu betreten …“
Ich hingegen interpretierte Albert ganz anders – die Idee einer Wahrheitsannäherung soll nicht aufgegeben werden. Ob man da nun etwas messen kann oder nicht, scheint mir sekundär.
Kurz und gut: Wir konnten uns nicht mal darüber einigen, was Hans Albert dazu gesagt hatte, geschweige denn, ob es so etwas wie Wahrheitsnähe überhaupt gibt.
3. März 2025 um 21:08
@ Timm Grams
Nur soviel dazu: Es würde ja schon hilfreich sein, eine strenge wissenschaftliche Methodik dann anzuwenden, wenn dies möglich wäre. Und um Daten interpretieren zu können, müssen sie zunächst einmal erhoben werden.
Sollte die strenge Anwendung wissenschaftlicher Methodik tatsächlich zu Engstirnigkeit und Unbelehrbarkeit führen, so wäre dies allerdings eher im Charakter des Forschers begründet. Borniert erscheinen mir hingegen die vielen Anhänger der CS, die nicht in der Lage zu sein scheinen, ihr Weltbild zu reflektieren. Womit ich zur Frage vordringe, woher diese Erkenntnis kommt, Herr Grams? Wissenschaftlich und methodisch korrekt gewonnen? Oder halt mal das Bauchgefühl in Worte gefasst?
5. März 2025 um 11:47
@ borstel 3. März 2025 um 21:08
Wer nur die naturwissenschaftliche Herangehensweise gelten lässt, muss nicht erst engstirnig werden. Da hilft ihm auch der Kritische Rationalismus, zu dessen Anhängern ich mich zähle, nicht heraus. Der Kritische Rationalismus funktioniert dort, wo man straflos immer und überall wirkende Gesetzmäßigkeiten voraussetzen darf. Schon bei der Psyche geht das nicht mehr. Ich habe bei Daniel Kahnemann einiges abgeschaut. Tatsächlich haben einige Kapitel seines Buches Thinking Fast and Slow die Replikationskrise der Psychologie nicht überstanden. Ich weigere mich auch, den Danning-Kruger-Effekt für Wissenschaft zu halten (Ig-Nobelpreis 2000).
Wissenschaft fängt mit dem Klassifizieren an. Bei komplexen Gegenstandsbereichen geht das nicht immer glatt und widerspruchsfrei; das habe ich bei meiner Arbeit am System der Denkfallen gesehen.
7. März 2025 um 21:32
@ Timm Grams
Ich habe jetzt lange überlegt, was ich darauf antworten soll. Ich bin ja kein Wissenschaftsphilosoph. Ich bin nur Feld-Wald-und-Wiesen-Mediziner, der immerhin soviel gelernt hat, daß er schlechte von guten Studien unterscheiden kann, und der ziemlich viel mit Dingen zu tun hat, die per se nicht wissenschaftlich erklärbar sind (zum Beispiel ein liebevolles Miteinander zwischen dem Patienten und seinem Ehepartner oder vollkommen irrationale Ängste gegenüber bestimmten Behandlungsverfahren).
Also habe ich das moderne Konversationslexikon unserer Zeit, Wikipedia, zu Herrn Kahneman und seinem Werk sowie noch einmal zum Kritischen Rationalismus befragt. Wahrscheinlich liegt es daran, daß ich keine Primärquellen gelesen habe oder einfach nur doof bin, aber ich kann Ihre Argumentation nicht nachvollziehen. Ich werde es mir jetzt ersparen, das weiter auszuführen, weil ich fürchte, daß dies zu nichts führen würde.
8. März 2025 um 18:38
@ borstel
In diesem Fall kann die Wikipedia wirklich helfen, insbesondere der Abschnitt Replikationskrise:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Schnelles_Denken,_langsames_Denken
9. März 2025 um 16:12
Ja, das habe ich gelesen. Und die Replikationskrise war mir aus der Medizin bereits ein Begriff. Nur kann ich mitnichten ableiten, daß zur Behebung des Mißstandes eine andere Herangehensweise sinnvoll wäre bzw. dies die Replkationskrise verhindert haben könnte.
10. März 2025 um 10:32
Die »wissenschaftliche Methoden als Grundlage für objektive Wahrheitsfindung« beschreibt die naturwissenschaftliche Herangehensweise. Aber bei soziologischen Studien wie »Die Arbeitslosen von Marienthal« geht es nicht um Wahrheitsfindung (https://www2.hs-fulda.de/~grams/hoppla/wordpress/?p=3744&cpage=1#comment-9800). Auch medizinische Tests (RCT) wären damit überfordert.
11. März 2025 um 18:55
Die Wahrheit ist halt irgendwo da draußen. Zur Kenntnis genommen.
14. März 2025 um 09:02
Hier noch ein Beitrag, der die Liste oben ergänzt https://jungle.world/artikel/2024/18/showdown-augsburg
Zerwürfnisse in der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP)
Showdown in Augsburg
Die kleine, aber feine Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften ist zerstritten. Bei einer Mitgliederversammlung am 11. Mai könnte es zur Spaltung kommen.