Narzisstische Charakterzüge und das Bedürfnis nach Einzigartigkeit begünstigen offenbar den Glauben an Verschwörungstheorien.
Eine aktuelle Studie des Psychologen Dr. Robert Luzsa von der Universität Passau differenziert in diesem Zusammenhang zwischen zwei Narzissmuskomponenten.
Demnach ist verschwörungstheoretisches Denken primär durch die Abwertung anderer (antagonistischer Narzissmus) motiviert und weniger durch Selbstbewunderung (agentischer Narzissmus).
Luzsa leitet aus seinen Erkenntnissen auch einen Ansatz für die Aufklärung ab:
Agentisch-selbstbewundernder Narzissmus war nicht mit Verschwörungsglauben assoziiert und könnte somit im Gegenteil als Ressource und Motivator begriffen werden.
So könnten etwa Interventionen kommunizieren, dass auf Verschwörungstheorien „hereinzufallen“ eine Schwäche darstellt und es erstrebenswert ist, diesen Narrativen und den dahinterstehenden Manipulationsversuchen überlegen zu sein. Somit würde die Tendenz zur Selbstbewunderung stimuliert, indem Rezipienten Stolz vermittelt wird, in der Lage zu sein, Fehler und Täuschungen in Verschwörungstheorien zu durchschauen.
Ziel wäre es, dem Verschwörungsglauben den Nimbus des Exklusiven, Überlegenen zu nehmen, um ihn somit für Rezipienten mit hohem Narzissmus unattraktiver zu machen.
Die Vermittlung einer solchen Sicht sollte dabei auf möglichst unterhaltsame, emotionale und kurzweilige Weise geschehen, da aus der Forschung bekannt ist, dass gerade auch der höhere Unterhaltungswert Verschwörungserzählungen gegenüber faktisch korrekten Nachrichten attraktiv macht.
Die Studie ist erschienen im Tagungsband der zweiten Wissenschaftskonferenz des Zentrums für Analyse und Forschung (ZAF) am Bundesamt für Verfassungsschutz.
Darin finden sich eine Reihe von weiteren interessanten Beiträgen. Die Publikation steht hier zum kostenlosen Download bereit.
Zum Weiterlesen:
- Wieso Narzissten eher an Verschwörungsmythen glauben, rnd am 23. August 2022
- Why do narcissists find conspiracy theories so appealing? Current Opinion in Psychology, Volume 47, October 2022
- Psychologie der Verschwörungstheorien: „Wir sind uns nicht mal mehr einig darin, was Realität ist“, FAZ am 9. Januar 2024
- Was Menschen anfällig für Fake News macht, dw am 3. November 2022
- „Epistemische Laster“ machen anfällig für den Glauben an Verschwörungstheorien, GWUP-Blog am 18. Juli 2021
- Faktoren des Glaubens an Verschwörungstheorien, GWUP-Blog am 28. Juni 2023, GWUP-Blog am 9. Februar 2024
- Too special to be duped: Need for uniqueness motivates conspiracy beliefs, European Journal of Social Psychology am 23. Mai 2017
- Verschwörungstheorien unter dem Blickwinkel der Forensischen Humanwissenschaften, Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie 2/2021
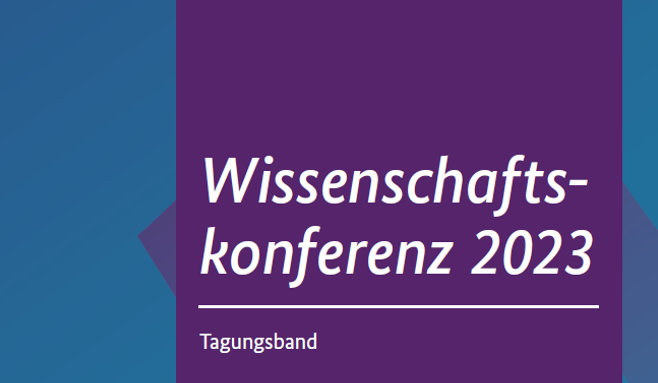
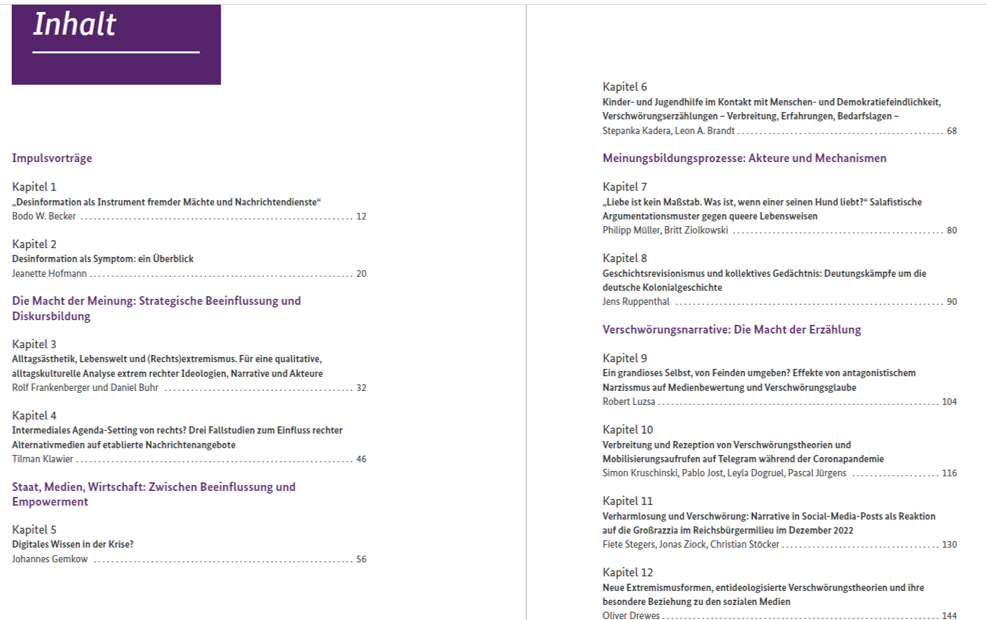
10. Juni 2024 um 20:10
N=234, arithmetisches Mittel des Alters: 25.9, 140 mit Hochschulabschluss…
Also unter Master-Studierenden Psychologie verhalten sich die beiden Narzistengruppen so oder so.
10. Juni 2024 um 22:04
Anekdotische Geschichte dazu, natürlich ohne jeglichen Anspruch auf Verallgemeinerung – vor einigen Jahren hatte ich etwas intensiveren Austausch mit einem (sogenannten) Klimaskeptiker.
Ein hochintelligenter Ingenieur im Ruhestand, den ich schon lange vorher kannte und von dem ich auch einiges gelernt habe. Eine psychologische Diagnose maße ich mir aber nicht an.
Er hatte mich damals mit ziemlich umfangreichen Dokumenten über die angeblichen Fehler von Klimamodellen versorgt – darunter viele Argumente, die m.E. darauf ausgelegt waren, oberflächlich schlau und plausibel zu wirken, aber einer detaillierten Prüfung nicht stand hielten.
Diese Detailfehler waren es dann, die ihn zum Nachdenken brachten: Konnte es sein, dass die Autoren besagter Dokumente – ganz offensichtlich hochgebildete und kluge Professoren – ihm etwas untergejubelt hatten?
Es war jedenfalls mein Eindruck, dass damals „die Angst auf etwas hereinzufallen“ mehr bewegt hat als es das alleinige Aufklären über Mythen oder das (sehr detaillierte) Erklären und diskutieren des Treibhauseffektes.
11. Juni 2024 um 09:37
@Philippe:
Eine schöne Anekdote – aber halt eine Anekdote. Eine Schwalbe macht leider noch keinen Sommer. In meiner Erfahrung, und in derjenigen der meisten anderen Skeptiker auch, vermute ich, nutzen intelligente Menschen ihre Fähigkeiten eher dazu, nach weiteren, noch schwerer zu widerlegbaren „Beweisen“ für ihre kruden Theorien zu suchen.