Seit heute läuft der 23. Bond-Film in den Kinos: „Skyfall“.
Zugleich feiert die Filmreihe ihr 50-jähriges Jubiläum.
Grund genug für eine kleine Serie, bei der wir unseren Rückblick auf die verschiedenen Abenteuer des Nonstop-Helden mit wissenschaftlichen Fragestellungen verbinden wollen.
Im ersten Teil geht es um Laserwaffen, die schon im dritten Bond-Film von 1964 („Goldfinger“) eine Rolle spielten:
Die Situation: In den Schweizer Alpen geht Bond dem König der Goldschmuggler in die Falle. Als er wieder aufwacht, ist er an Händen und Füßen gefesselt und liegt unter einer Art riesigem „Laser-Pointer“, der ihn in zwei Hälften zerschneiden soll. Genüsslich schaut Goldfinger zu, wie der rote Strahl sich langsam Bonds Unterleib nähert.
Das sollte unser Agent tun: Sich gemütlich zurücklehnen – und sich einfach vorstellen, er sei ein Preisschild auf einer Tüte Paprikachips, das gleich an der Kasse eingescannt wird.
Wieso? Der rote Laserstrahl zeigt, dass es sich sehr wahrscheinlich um einen harmlosen Helium-Neon-Laser handelt. Denn im roten Spektralbereich sind Dioden- und HeNe-Laser am gebräuchlichsten.
Beide erreichen indes keine Leistung, die für eine ernsthafte Materialbearbeitung ausreichen würde. Früher fand man Helium-Neon-Laser beispielsweise in den Barcodescannern von Registrierkassen oder Laserdruckern, dort sind sie allerdings fast vollständig von Diodenlasern verdrängt worden. Heute finden Helium-Neon-Laser unter anderem noch in der Holografie und vor allem in der Forschung Anwendung.
Es gibt zwar auch deutlich stärkere rote Laser, etwa Krypton- oder auch Rubin-Laser, die brennbares Material zumindest leicht zum Kokeln bringen – allerdings sieht das bei weitem nicht so eindrucksvoll aus wie in „Goldfinger“.
Außerdem würden es die beiden Protagonisten nicht ohne Schutzbrille in der Nähe eines solchen in Betrieb befindlichen Laser-Ungetüms aushalten. Alleine das Streulicht würde derart blenden, dass man sich die Augen zuhalten oder zumindest den Blick abwenden müsste. Ein launiger Dialog wie zwischen Bond und Goldfinger käme dann schwerlich zustande.
Was Goldfinger bräuchte, wäre ein Kohlendioxid-Laser. Dieser zählt – neben Faser- und Scheibenlasern – zu den leistungsstärksten Industrielasern und wird zur Materialbearbeitung, etwa von Blech, Baustahl oder Edelstahl, eingesetzt.
Ein hochenergetischer CO2-Laser hätte allerdings den Nachteil, dass das zu zerschnipselnde Opfer den Strahl gar nicht sehen könnte, da die Wellenlänge deutlich über dem Bereich des sichtbaren Lichts liegt.
Dasselbe gilt für die finale Weltraum-Schlacht in „Moonraker“, bei der tödliche blaue und grüne Laserstrahlen zwischen den amerikanischen Space-Marines und Hugo Drax’ Leuten hin und her zischen:
In Wirklichkeit könnte man die Laserstrahlen gar nicht sehen, weder im All noch hier unten auf der Erde.
„Laser” ist die Abkürzung für „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”:
Laser erzeugen eine besondere Art künstlichen Lichts, das sich von natürlichem Licht wesentlich unterscheidet, nämlich eine Serie von Lichtteilchen (Photonen), die sich nur in eine spezifische Richtung ausbreiten. Natürliche Lichtquellen erzeugen Photonen, die sich in alle möglichen Richtungen ausbreiten.
Ein Laser strahlt darüber hinaus Photonen mit nur einer Frequenz aus. Dadurch kann der Laserstrahl eng zusammen bleiben und damit gebündelt. Ein Laserstrahl ist also nichts anderes als gebündeltes Licht einer bestimmten Wellenlänge. Und Licht können wir nur dann sehen, wenn es direkt in unser Auge fällt, und dazu muss es von irgendeinem Objekt gestreut werden.
Das ist derselbe Effekt wie im Kino: Wir sehen das Licht des Projektors nur auf der Leinwand, aber nicht im Raum. Nur wenn geraucht wird oder viel Staub in der Luft schwebt, sieht man den kegelförmigen Lichtstrahl. Im Weltraum aber sind nicht genügend Streuzentren vorhanden.
Wir würden also die Laserstrahlen von Raumschiffen oder Sternenkriegern nicht als Leuchtspur sehen können. Sie wären unsichtbar und nur kurz als Lichtpunkt wahrnehmbar, wenn sie auf ihr Ziel auftreffen.
Und da wir schon im All sind: Sicher, lautlose Explosionen sind langweilig. Nichtsdestotrotz vergehen Raumstationen wie die des größenwahnsinnigen Industriellen Hugo Drax nur im Kino in exquisitem Dolby-Surround-Sound:
Schall reist, anders als Licht und andere elektromagnetische Wellen, mithilfe der Kompression eines Mediums vorwärts. Auf der Erde werden die Luftmoleküle immer von der Stelle ausgehend, wo ein Geräusch entsteht, zusammengepresst und breiten sich als Druckwelle von diesem Punkt aus.
Im All aber gibt es überhaupt keine Luft und daher können sich keine Geräusche fortbewegen. Laute Explosionen oder das Aufjaulen von Triebwerken sind eine dramaturgische Erfindung:
Und Laserwaffen? Sie gehören schließlich zu den Lieblingsspielzeugen von Super-Size-Schurken.
In „Diamantenfieber“ erpresst Ernst Stavro Blofeld die Atommächte mit einer satellitengestützten Laserkanone:
In „Stirb an einem anderen Tag“ plant Gustav Graves (beziehungsweise Colonel Moon) mit einem Orbital-Laser namens „Ikarus“ eine Schneise in das Nord- und Südkorea trennende Minenfeld zu brennen und so dem Norden die Invasion in den Süden und damit die Wiedervereinigung des koreanischen Volkes zu ermöglichen:
Dass Logik nicht die stärkste Seite von kriminellen Irrläufern ist, daran haben wir uns fast schon gewöhnt.
Die allererste Frage wäre, warum Graves/Moon mit seiner Doomsday-Waffe einem Krieg zwischen Nord- und Südkorea mit Hunderttausenden Soldaten und ungewissem Ausgang den Weg ebnen will – anstatt gleich Seoul oder zumindest den Regierungssitz und die Militäranlagen zu zerstrahlen? Questions are forever.
Wie auch immer: Es gibt viele verschiedene Arten von Laser, die nicht nur nach ihrer Stärke, sondern primär nach ihrem Gefahrenpotenzial eingeteilt werden – in Klassen von I bis IV.
Graves würde in jedem Fall einen Laser weit jenseits eines normalen Klasse-IV-Lasers benötigen, etwa einen CO2-Laser, der Brände und Explosionen verursachen kann, weil die Strahlung am Ziel absorbiert und in Wärme umgewandelt wird.
Dann aber stellt sich gleich die nächste Frage: Wie schafft er dieses Teil ins All?
Ein Laser, der einen Todesstrahl erzeugen kann, der Hunderte Kilometer durch alle Schichten der Erdatmosphäre dringt und im Weiteren auch von Wolken, Regen, Wind nicht nennenswert beeinträchtigt wird, hätte gigantische Ausmaße. Er fände weder in einem Satelliten noch an Bord eines Space Shuttles Platz, allenfalls in einer Raumstation.
Hätten die Macher von „Stirb an einem anderen Tag“ ein halbwegs realistisches Szenario im Sinn gehabt, hätten sie einen chemischen Laser zeigen müssen beziehungsweise Gustav Graves/Colonel Moon in eine Boeing 747 gesetzt, mit zwei bis drei Lkw-Ladungen Ethylen C2H4, NF3 und einer Helium-(He)-/Deuterium- (D2)-Gasmischung. Dabei entsteht reaktives Deuteriumfluorid (DF) als Abgas. Im angeregten Zustand speist das DF den Laser.
Dieser neue Hochenergie-Laser, der in den USA unter der Bezeichnung THEL (Tactical High-Energy Laser) entwickelt wird, zeigte seine durchschlagende Wirkung schon bei einer Vorführung im August 2004.
Auf dem Raketentestgelände White Sands in New Mexico holte THEL reihenweise klein- und großkalibrige Raketen sowie Artillerie- und Mörsergranaten vom Himmel, auch wenn sie in Salven abgefeuert wurden. Seither bekundet die US-Armee regelmäßig Interesse an einem baldigen Kampfeinsatz der Hightech-Waffe.
Der limitierende Faktor für einen einzelgängerischen Schurken wären allerdings nicht nur die Unmengen an Brennstoff, die man für einen kontinuierlichen Betrieb benötigen würde. Darüber hinaus hat die THEL-Kanone nur eine Reichweite von fünf Kilometern und stößt beim Betrieb giftige Dämpfe aus. Ein paar Minen damit zu zerstören, hätte indes auch Graves/Moon wohl geschafft.
Ein vergleichsweise neues Szenario in Sachen „Laserwaffen“ ist der YAL-1 Airborne Laser.
Sind wir also gespannt auf den neuen Bond-Film, sagen wir, im Jahr 2020.
(Fachliche Beratung: Dr. Philippe Leick)
Teil 2: Die Sache mit dem Gold
Zum Weiterlesen:
- Bernd Harder/Claudia Preis: Der Bond-Appeal. Knaur-Verlag, München 2008
- Metin Tolan: Geschüttelt, nicht gerührt – James Bond und die Physik. Piper-Verlag, München 2010
- Lois H. Gresh/Robert Weinberg/Joachim Körber: Die Wissenschaft bei James Bond. Wiley-VCH Verlag, Weinheim 2008
- James-Bond-Spezial 2: Die Sache mit dem Gold, GWUP-Blog am 2. November 2012
- James-Bond-Spezial 3: Die Sache mit dem Flugzeugfenster, GWUP-Blog am 3. November 2012
- James-Bond-Spezial 4: Die Sache mit dem Piranhas, GWUP-Blog am 4. November 2012
- James-Bond-Spezial 5: Die Sache mit der Brücke, GWUP-Blog am 4. November 2012
- James-Bond-Soezial 6: Die Sache mit dem Beißer, GWUP-Blog am 6. November 2012
- James-Bond-Spezial 7: Cold Reading mit James Bond, GWUP-Blog am 7. November 2012
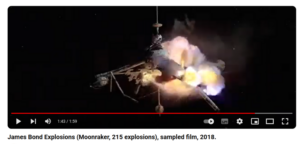
2. November 2012 um 00:31
Die ultimative Laserwaffe fehlt hier noch, auch wenn’s kein James Bond ist: Das Laserschwert. Ein Lichtstrahl der in Luft langsam ausfährt, nach 1,5 m schlagartig aufhört und sich wahlweise wie feste Materie (beim Fechten) oder wie ein Schneidwerkzeug verhält.
Möge die Macht mit Euch sein.
3. November 2012 um 08:07
Hmmm… ich kenne so gut wie jeden Science-Fiction-Film… ein Film, in dem mit ‚Laserschwertern‘ gekämpft wird, ist mir nicht bekannt…
Vielleicht ist da jemand der mangelhaften Übersetzung der deutschen Synchronbarbeitung aufgesessen… das wäre übrigens auch mal wieder ein Thema: Mangelnde Ausbildung von Übersetzern im (populär-)wissenschaftlichen und journalistischen Bereich… wenn Billions zu Billionen werden und Silicon zu Silikon wird… ;)
3. November 2012 um 10:51
Icarus in „Die Another Day“ war gar kein Laser, sondern ein riesiger Spiegel, der Sonnenlicht fokussierte, so wie es Solarschmelzöfen tun, nur gigantisch und im All…
3. November 2012 um 15:17
Da muss ich jetzt mal etwas korrigieren. In technischen Anwendungen ist es häufig üblich, einem unsichtbarem Laserstrahl noch einen sichtbaren beizumischen. Damit kann man besser zielen. Somit könnte da schon ein CO2 Laser als „Hauptlaser“ drin gewesen sein.
Zweitens gibt es natürlich Lichtquellen die nach einer definierten Entfernung aufhören. Das macht, laut Packungsaufdruck, fast jede Taschenlampe. Dort wird damit geworben, dass die Teile nur 40 Meter oder so leuchten. Sonst könnte man die Importeure ja abmahnen.
3. November 2012 um 23:56
@Thomas
Im dt. Sprachraum hat sich eben diese Übersetzung anstelle von Lichtsäbel etabliert, auch die Spielzeugindustrie hat diese Übersetzung angenommen. Aber egal, besser wird es auch mit korrekter Übersetzung nicht.
Abgesehen davon, ob es sich bei der Übersetzung um einen Fehler des Übersetzers halte ich in diesem Falle für nicht so sicher. Für meine Ohren klingt Lichtsäbel irgendwie holprig, Laserschwert hört sich für mich eleganter an, auch wenn das Eine wie das Andere Unsinn ist.
@Christian Berger
… aber nicht schlagartig, wie abgeschnitten, oder? Und eine Taschenlampe, bei der nach 1,5 m zappenduster ist, ist eine Abmahnung wert ;-)
5. November 2012 um 11:53
@Feuerwächter
Nein, da muss ich Thomas zustimmen – in der Deutschen Fassung wird nicht von einem Laser- sondern von einem Lichtschwert gesprochen.