Heute, passend zu Allerheiligen, erscheint das Buch der Passauer Autorin und „Spuknacht“-Veranstalterin Lucia Moiné
An der Schwelle des Todes: Unheimliche Erlebnisse in Krankenhäusern und Pflegeheimen
Es geht darin um Augenzeugenberichte von sogenannten Sterbebettphänomenen (Deathbed phenomena, nicht zu verwechseln mit Nahtoderlebnissen):
Seien es nun Erscheinungen am Totenbett, unheimliche Schatten und Schritte während des Nachtdienstes, schwarze Hunde oder das viel berichtete Betätigen der Notglocke in Zimmern kürzlich Verstorbener.
Eine virtuelle Book-Launch-Party gibt’s heute Abend (1. November) von 20 – 22 Uhr bei Facebook.
Mit der Expertise des Neuropsychologen und GWUP-Wissenschaftsratsmitglieds Prof. Peter Brugger habe ich ein Gastkapitel beigesteuert, das den vielen subjektiven Erlebnisschilderungen eine skeptische Betrachtungsweise gegenüberstellt. Da dieses Thema bislang wenig beackert wurde und unsere kritische Einschätzung auch online auffindbar sein sollte, veröffentlichen wir den Beitrag hier in voller Länge.
—————————————————————————————————————————————————
Sterbebettphänomene: „Unser Gehirn ist erstaunlich assoziativ“
Meine Mutter starb am 4. Juli 2008. Zwölf Tage vor ihrem Tod wurde ich Zeuge eines Sterbebettphänomens. Es ereignete sich im Krankenzimmer meiner Mutter, während ich mit ihr allein war. Erklären konnte ich mir dieses Erlebnis damals nicht – wie vieles andere während ihrer letzten Lebensphase.
Warum hörte sie plötzlich auf zu essen?
Natürlich machten wir uns große Sorgen. Sogar über eine Magensonde zur enteralen Ernährung sprachen meine Schwester und ich mit dem Arzt. Bitte bloß etwas unternehmen! Ich bin froh, dass wir nicht darauf bestanden haben. Heute weiß ich: Du stirbst nicht, weil du nichts mehr isst. Du isst nichts mehr, weil du stirbst.
Wieso blühte meine Mutter kurz vor ihrem Tod noch einmal auf, zur Überraschung aller?
Verlangte nach ihrem Lieblingsgetränk und machte den Eindruck, als würde sie gleich aufstehen, sich anziehen und mit uns nach Hause fahren. Heute weiß ich: Das ist das letzte Licht am Anfang des Tunnels. Auch dieses Aufflackern geht vorüber.
Warum wollte meine Mutter plötzlich keinen von uns mehr sehen?
Drehte sich weg zur Wand, wenn wir da waren. Heute weiß ich: Sie konnte nicht mehr, aber es fehlte ihr die Kraft, es zu sagen.
Wie konnte meine Mutter den Zeitpunkt ihres Todes anscheinend beeinflussen?
Fast so, als wollte sie uns ein Schnippchen schlagen und gerade dann gehen, als niemand bei ihr war. Heute weiß ich: Vielleicht wollte sie allein sein. Vielleicht hat auch nur das Schicksal entschieden.
Und was hatte es mit der Gestalt auf sich, die sie etwa zwei Wochen vor ihrem Sterben im Krankenzimmer sah?
Es ereignete sich am helllichten Tag, meine Mutter war zu diesem Zeitpunkt noch halbwegs guter Dinge, völlig klar im Kopf und weit entfernt von einem Delir. Ich stand an ihrem Krankenbett, wir unterhielten uns über dies und das, als sie auf einmal lächelte und mit einer Kopfbewegung auf etwas hinter mir deutete. „Da steht ein großer schwarzer Engel“, schilderte sie mir in ganz normalem Tonfall.
Unwillkürlich drehte ich mich um, aber da war niemand. Also fragte ich meine Mutter: „Und was macht der?“ Sie lächelte immer noch und sagte ruhig: „Er passt auf uns auf.“
Ich habe diese Begebenheit nie vergessen, auch wenn ich ihr damals keine große Bedeutung zumaß. Wie ich heute weiß, kommt es vor, „dass Sterbende Menschen zu sehen glauben, die sonst niemand sieht“, schreibt der Journalist Roland Schulz in seinem kraftvollen Buch „So sterben wir“, in dem er die Leser anschaulich mit auf die letzte Reise nimmt:
Eine Frau wiegt einen unsichtbaren Säugling; später erklärt ihr Ehemann, ihr Erstgeborener war eine Totgeburt. Ein lange obdachloser Mann sieht abends die Polizei anrücken, ohne fliehen zu können; ein anderer riecht das Parfüm seiner Mutter, die starb, als er ein Kind war.
Eine fast hundertjährige Frau grüßt die leere Ecke ihres Zimmers, wo sie ihre vor Jahrzehnten verstorbene Schwester wahrnimmt.
Es ist also keinesfalls so, dass Skeptiker außergewöhnliche Erfahrungen rundheraus bestreiten.
Ich nicht, und auch der Schweizer Neuropsychologe Professor Peter Brugger nicht. Brugger nennt sich selbst einen „konvertierten Gläubigen“. Von übersinnlichen Erscheinungen war er einst felsenfest überzeugt. „Ich habe sogar mein Biologiestudium begonnen, um diesen Phänomenen nüchtern auf den Grund zu gehen“, berichtet er. „Ich habe mir Experimente ausgedacht, um herauszufinden, wie bei einer Gedankenübertragung die Information von einem Gehirn ins andere gelangt.“
Doch bei seinen Versuchen kam nichts heraus – „weil da eben nichts ist“, wie er heute sagt.
Trotzdem machte er weiter, richtete aber seine Forschung ganz neu aus: „Ich untersuchte plötzlich nicht mehr die Phänomene selbst, sondern den Glauben an sie.“ Brugger ist Mitglied im Wissenschaftsrat der GWUP und leitete die Neuropsychologische Abteilung der Klinik für Neurologie am Universitätsspital Zürich.
Zum Thema „Sterbebett-Phänomene“ sagt er:
Ich bin nicht skeptisch gegenüber Erfahrungen in Todesnähe, ob sie nun beim Sturz von der Felswand oder auf dem Sterbelager gemacht werden. Solche Erlebnisse sind eine Tatsache, da geht es nicht um Glaube oder Unglaube.
Wenn es aber darum geht, diese Erlebnisse als Hinweis für ein Leben nach dem Tod darzustellen, bin ich mehr als ein bloßer Skeptiker – hier werden Ebenen verwischt. Auf wissenschaftlicher Ebene ist es genauso unsinnig, sich zu einem Leben nach dem Tod zu äußern, wie etwas über die Existenz Gottes aussagen zu wollen. Die Frage nach einem Leben nach dem Tod ist wie die Frage nach Gott eine Frage, die auf Glaubensebene diskutiert werden sollte.
Ich finde beide Ebenen interessant und denke, dass es im klinischen Alltag wichtig ist, beide vor sich zu haben.
Interessant – auf jeden Fall.
Tröstlich? Ich weiß nicht, was der Engel für meine Mutter bedeutete. Ich kann das Erlebnis nur von außen beschreiben. In mir selbst löste ihre Schilderung nichts aus.
Ein Beweis für eine Realität, die normalerweise unserer Wahrnehmung entzogen ist? Gewiss nicht.
Und das ist genau das Problem, das ich mit den Berichten von Sterbebettphänomenen habe. Anders als Nahtod-Erlebnisse (die recht unspektakulär mit einem „Neuronen-Feuerwerk“ erklärt werden können, welches das Gehirn in Ausnahmezuständen abfeuert) sind Sterbebettphänomene praktisch immer etisch, beruhen also auf der Außensicht einer betreuenden Person.
Und sie enden sehr häufig mit deren Glaubensbekenntnissen wie
- „Das Beweismaterial spricht in hohem Maße für ein Leben nach dem Tod.“
- „Wir können sicher sein, dass wir Menschen den Tod nicht mehr zu fürchten brauchen.“
- „Ich möchte Ihnen die Gewissheit geben, dass der Tod kein Ende ist.“
Manche Chronisten heben besonders den Umstand hervor, dass Sterbebettphänomene nicht auf ein vorhandenes Delirium zurückgeführt werden könnten – als wenn das ein unwiderlegbares Argument für die Echtheit wäre. Auch meine Mutter war weder delirant noch eine religiöse Schwärmerin, als sie den schwarzen Engel erblickte.
Wie Professor Peter Brugger erklärt, ist das jedoch mitnichten ein Widerspruch – sondern im Gegenteil sogar die Voraussetzung dafür, dass Sterbebettvisionen als realistisch und sinnvoll erlebt werden können.
Denn:
Ein Delir würde wahrscheinlich gerade verhindern, dass das Außergewöhnliche an diesem Zustand beruhigend und verklärt erlebt werden kann. Und religiöser Fundamentalismus trübt das Denken ganz allgemein ein, wie er das ja auch in sterbefernen Momenten tut.
Die Begrenztheit der etischen Betrachtungsweise wird exemplarisch deutlich an einem Interview, das die Pflegefachfrau Margarete Reisinger zu ihrer Masterarbeit „Sterbebettphänomen“ im berufsbegleitenden Masterstudiengang MAS Palliative Care dem Blog der Stiftung Palliaviva gab.
Einige Zitate daraus:
Reisinger: Der Zeitpunkt, wann das Sterbebettphänomen auftritt, variiert stark: Meistens tritt es 24 Stunden vor dem Sterben auf, ich habe es aber oft auch schon früher erlebt. Manchmal eine Woche bis zu einem Monat vorher. Mich dünkt es, zuweilen tritt das Phänomen früh auf, wenn es noch etwas zu erledigen gibt oder als eine Art Vorbereitung auf das Sterben. Aber das ist meine eigene Interpretation.
Es geht also letztendlich um die Deutung des Erlebten. Und hier macht die Beobachterin keinen Unterschied mehr zwischen dem, was sie empfunden hat bei ihrem Umgang mit Menschen, die verstorben sind, und dem, was sie daraus folgert. Dieser Rückschluss von subjektiver Gefühlsbewegung auf die Realität ist indes nicht mehr als Spekulation.
Reisinger: Ich habe das Gefühl, dass es nach dem Sterben weitergeht.
Das Gefühl mag sie – verständlicherweise – haben.
Reisinger: Gerade die Bilder des Abholens oder der Reise lassen mich hoffen, dass ich Freunde und Verwandte wieder antreffe.
Die Hoffnung mag sie – verständlicherweise – haben.
Reisinger: Nein, ehrlich gesagt habe ich die Gewissheit, dass es nach dem Tod ein Leben gibt. Vielleicht habe ich deshalb das Thema gewählt.
Und schon ist aus dem verständlichen Gefühl und der verständlichen Hoffnung eine – illusorische – „Gewissheit“ entstanden.
Zwingend sind solche emotionalen Interpretationen von Sterbebettphänomenen jedoch mitnichten. Auch Prof. Brugger kennt solche Berichte aus erster Hand:
In einem Akutspital ereignen sich über die Jahre viele Todesfälle, und wenn man engen Kontakt zu den einzelnen Patienten pflegt, ist man auch oft ein Begleiter.
Tatsächlich sind Begegnungen mit verstorbenen Verwandten fast ein Leitmotiv. Das ist eigentlich nicht erstaunlich, da die Erwartungshaltung unsere Wahrnehmung schon zeitlebens in viel stärkerem Maße beeinflusst, als man sich das zugesteht. Eine sterbende Person braucht nicht einmal an ein Weiterleben nach dem Tod zu glauben, um dennoch typische Sterbebettphänomene zu erleben.
Der Gedanke an den eigenen Tod lässt auch beim Nicht-Gläubigen Bilder an Verwandte oder Freunde aufkommen, die sich bereits früher verabschiedet haben. Unser Gehirn ist erstaunlich assoziativ. Eine Frage der Wissenschaft ist, warum Assoziationen sich auf dem Sterbebett vornehmlich in Bildern zeigen.
Eines lässt sich daraus jedoch eindeutig schlussfolgern: Es war richtig, die Präsenz des schwarzen Engels im Krankenzimmer meiner Mutter nicht kritisch zu hinterfragen und nicht mit ihr zu erörtern.
Brugger hat ähnliche Erfahrungen gemacht:
Begleite ich eine Person auf ihrem Sterbebett, diskutiere ich nicht die – fehlenden! – wissenschaftlichen Grundlagen für ein Weiterleben. Der Inhalt einer Sterbebetterfahrung spendet meist Trost. Einer der eindrücklichsten Fälle, die ich erlebt habe, kommt mir dazu in den Sinn:
Bei einem Mann, der immer dynamisch und sportlich gewesen war, wurde im 40. Lebensjahr ein bösartiger Tumor diagnostiziert. Ausfälle wie Lähmungen oder Sprachstörungen hatte er nicht, er sprach bloß viel mehr als zuvor. Seine Angst vor dem Tod verlor er durch freundliche Gestalten, die ihn am Bett besuchten und baten, doch „zu ihnen hinüberzukommen“. Es waren ihm unbekannte Personen, aber sie erschienen ihm so echt, „mehr als wirklich“, dass er seine Angst verlor, nicht zuletzt auch, weil er auch merkte, dass er ja widerstehen konnte. Das Bitten blieb freundlich, wurde aber über die Monate hinweg immer inbrünstiger.
Vielleicht hat er ihm schließlich einfach nachgegeben. Jedenfalls verstarb er eines Tages komplikationslos und friedlich.
Menschen, die in Sterbebettphänomenen einen Beweis für das Drüben sehen, argumentieren zuweilen, dass die Berichte „weder durch medizinische noch durch psychologische oder kulturelle Bedingungen erklärt werden“ könnten.
Das ist aber der falsche Ansatz. Es geht nicht um ein „oder“ und ein „weder noch“, sondern um multikausale Zusammenhänge, erklärt Brugger:
Viele einzelne Elemente von Sterbeerlebnissen sind noch ungeklärt. Ich glaube aber nicht, dass sie „unerklärlich“ sind. Wir wissen einfach noch zu wenig über sie.
Viele Faktoren – organische, „rein psychologische“, aber auch kulturelle – müssen berücksichtigt werden. Wie Nahtoderlebnisse sind auch Sterbebettphänomene niemals nur neurologisch oder nur kulturell zu erklären. Gehirne leben in Personen und jede Person ist Teil einer Gesellschaft. Eng neurowissenschaftlich argumentierende Forscher lesen kaum sozialpsychologische Arbeiten, welche die Unterschiede in Sterbebetterfahrungen in unterschiedlichen Religionen hervorheben. Umgekehrt kennen sich viele Sozialpsychologen oder Anthropologen wenig auf klinischem und neurowissenschaftlichem Gebiet aus.
Oft wird argumentiert, dass die „Überwirklichkeit“ oder „Hyperrealität“ eines Erlebnisses (auch für den oben zitierten Patienten war sie ausschlaggebend) ein Hinweis sei für eine „Welt jenseits der unseren“. Man weiß aber, dass das Gefühl, wonach Erlebtes „wirklicher ist als alles je zuvor Erlebte“, ein Indikator ist für temporallappenepileptische Aktivität.
Solche „Hyperrealität“ wird in allen Kulturen beschrieben, ob sie nun von christlicher Kirchenmusik begleitet ist oder von buddhistischen Zimbelklängen.
Aber was ist mit scheinbar objektiven Beweisen für etwas Übersinnliches? Mit eigenartigen Erlebnissen in Krankenhäusern oder Pflegeheimen, bei denen sich das Unerklärliche in technischen Artefakten manifestiert, wie zum Beispiel dem Läuten der Notglocke in leeren Patientenzimmern? Moderne Mythen?
Ja – meint Brugger. Aber so modern seien sie nun auch wieder nicht:
Seit jeher machen sich Mythen dort breit, wo gesichertes Wissen fehlt. Wissenschaft ist manchmal kalt und unromantisch, aber um zu beurteilen, ob das Läuten der Notfallklingel mehr als ein bedeutungsvoller Zufall war, müsste man einige nüchterne Tatsachen kennen:
Hörten alle Anwesenden die Klingel? Wie oft hörte jemand die Klingel zu Zeiten, in denen niemand starb? Welches ist der Zeitraum, in dem das technisch nicht erklärbare Klingeln noch mit dem Ableben einer Person assoziiert werden darf?
Und vieles mehr.
In dieselbe Kategorie fallen die prognostischen Fähigkeiten von Tieren, die den Tod nahestehender Menschen vorauszusehen scheinen.
Weltbekannt wurde die Therapiekatze Oscar, die im Steere House Nursing and Rehabilitation Center in Providence, Rhode Island, lebt. Der Kater wuchs in der Abteilung für Demenz des Pflege- und Rehabilitationszentrums auf. Dort werden Patienten mit Alzheimer, Parkinson und anderen Krankheiten behandelt.
Nach einiger Zeit fiel den Pflegern auf, dass Oscar in dem Heim seine eigenen Runden machte, ganz wie die Ärzte und Krankenschwestern. Er roch an Patienten, beobachtete sie und setzte sich neben Menschen, deren Tod innerhalb weniger Stunden bevorstand.
Etwa 100 Fälle soll der Kater vorausgesagt haben.
Experten verschiedener Fachrichtungen gaben unterschiedliche Erklärungen für das Phänomen ab. Etwa dass die Katze sensibel auf den Geruch des Todes reagiere, der von bestimmten Chemikalien erzeugt wird. Oder dass sie auf die Bewegungsarmut der sterbenden Personen reagiere. Oder dass Katzen einfach ein Gespür dafür hätten, wenn es ihren Besitzern schlecht geht.
Aber vielleicht sind die entscheidenden Fragen ganz andere.
Zum Beispiel: Wie solide ist eigentlich die Basis für die Behauptung, die Katze könne den Tod vorausahnen? Hat die Katze ungehinderten Zugang zu allen Patienten? Wie oft besucht sie jeden Patienten und wer kontrolliert dies? Wie lange muss der Besuch dauern, um als Zeichen des bevorstehenden Todes gewertet zu werden?
Folgt das Tier vielleicht nur dem Pflegepersonal, das einigen Patienten mehr Zeit widmet als den anderen? Bieten sich die Zimmer der Betroffenen aus anderen Gründen als Katzen-Besuchsort an? Schätzen Ärzte den Zustand der Patienten genauso ein wie der Kater?
Ähnlich mag es sich mit außergewöhnlichen Empfindungen verhalten, die als Todesomen gedeutet werden. Wie in dieser Geschichte, die in dem Wochenmagazin Stern (44/2003) zu lesen stand:
Frank ist ein guter Junge und überrascht seine Mutter ab und zu mit einem Geschenk. Über eine hübsche Kristallschale freut sie sich besonders. Deshalb bekommt die Schale einen Ehrenplatz auf der Anrichte. Einige Zeit später erkrankt Franks Schwester an Windpocken und der Bruder wird vorsichtshalber zu den Großeltern geschickt, die rund siebzig Kilometer entfernt leben.
Eines Morgens dann sitzt Franks Mutter mit einer Nachbarin beim Frühstücksplausch. Plötzlich zerspringt die Kristallschale, die Frank ihr geschenkt hat, in zwei Teile. „Mein Gott, Frank ist tot!“, schreit die Mutter auf. Sie lässt sich nicht beruhigen und bleibt weiter bei ihrer hellseherischen Behauptung. Zu Recht, wie sich bald herausstellt: Ein Nachbarsjunge der Großeltern hatte Frank die Waffe seines Vaters gezeigt – ohne zu wissen, dass sie geladen war.
Genau in dem Augenblick, in dem die Kristallschale zersprang, berichtet später seine Schwester, wurde Frank tödlich getroffen.
Wenn der Analytiker in uns mal Pause hat, weil das Immunsystem der Seele gerade heruntergefahren ist, spüren wir die emotionale Kraft solcher Geschichten. Aber was ist wirklich dran? Schauen wir uns ganz nüchtern die Geschichte von Frank und der zerbrochenen Kristallschale an.
Keine Kamera war dabei, die das Unerklärliche dokumentierte. Keine Uhr hat gemessen, wann genau die Schale zersprang und wann der Sohn starb. Alles, was bleibt, ist die Erinnerung daran.
Es genügt schon, die oft völlig entgegengesetzten Zeugenaussagen nach einem Autounfall anzusehen, um unserem Gedächtnis nicht mehr fraglos zu trauen. Psychologen wissen, wie sehr unser Gehirn nach einer Erklärung sucht, wenn die wahrgenommenen Fakten keine tragende hergeben.
Und je mehr wir emotional betroffen sind, desto drängender wird es für uns auch, die Puzzlestücke der subjektiven Erinnerungen zu einem harmonischen Bild zusammenzufügen, das unseren tiefsten Wünschen entspricht. Skeptiker bezweifeln durchaus nicht die Aufrichtigkeit des Erzählenden – sondern die Genauigkeit der Erinnerung.
Oder:
Eine Mutter träumt eines Nachts, dass ihr 18-jähriger Sohn mit seinem Motorrad verunglückt ist. Eine Stunde später klingelt die Polizei an der Tür und bestätigt die schreckliche Ahnung.
Aber könnte es nicht auch so gewesen sein: Die Mutter wusste, das ihr Sohn gerade erst den Führerschein gemacht hatte und ein unsicherer Fahrer war. Immer, wenn der Junge mit dem Motorrad unterwegs war, dachte sie voller Unruhe an einen möglichen Unfall. Nie war etwas passiert – bis auf diese besagte Nacht. Plötzlich trafen die schon lange gehegten Befürchtungen mit einem realen Ereignis zusammen.
Und das Ganze wurde im Nachhinein zu einem scheinbar übersinnlichen Erlebnis.
Und warum blieb die Uhr stehen, als Opa starb?
Der Physiker Richard Feynman erlebte dieses Phänomen beim Tod seiner ersten Frau. Er sah, dass ihr Wecker auf dem Tisch neben ihrem Krankenhausbett genau zu der Minute stehenblieb, in der seine Frau laut Sterbeurkunde gestorben war.
Diese seltsame Übereinstimmung ließ dem berühmten Naturwissenschaftler keine Ruhe. Er begann nachzuforschen. Und im Nachhinein stellte Feynman fest, dass der Arzt die Todeszeit, die in der Sterbeurkunde angegeben war, von genau jenem Wecker am Krankenbett abgelesen hatte.
Zu diesem Zeitpunkt war die Uhr aber schon lange stehengeblieben, mindestens eine halbe Stunde zuvor.
Sind solche Erklärungen verkopft und irgendwie unbefriedigend? Mag sein. Machen diese Erklärungen Betroffene und deren Erlebnisse lächerlich? Nein.
Es geht nicht darum, die Beweiskraft von Augenzeugen und Erlebtem in Zweifel zu ziehen, sondern die Beweiskraft kritisch zu bewerten. Und das ist nicht ganz leicht, angesichts des riesigen Täuschungspotenzials von uns Menschen, das den meisten gar nicht bewusst ist. Wichtiger ist denn auch die Frage, wie Angehörige, Ärzte oder Pflegekräfte mit Sterbebettphänomenen umgehen sollten.
Brugger rät:
Was ganz genau vor sich geht, kann bisher niemand mit letzter Sicherheit aufzeigen. Es gibt aber keinen Grund, zu denken, dass hier „Übersinnliches“ oder „Paranormales“ im Spiel wäre.
Sowohl für die Psyche wie auch für das organische Substrat, das unauflöslich mit psychischem Erleben verbunden ist, ist Todesnähe außergewöhnlich. Angehörige oder Pflegepersonal tun wohl am besten daran, bekräftigend und staunend den Berichten einer sterbenden Person zu lauschen.
Psychologisches Wegerklären hat in solchen Momenten ebenso wenig Platz wie medizinische Halbweisheiten.
Oder, wie Roland Schulz in seinem „furchtbaren und grandiosen“ Buch mahnt:
Keiner kann wissen, was im Tod ist. Im Sterben stoßen der Verstand, das Denken, die Vernunft an ihre Grenzen. Da gibt es keine Gewissheiten mehr. Sicher ist jedoch: Sterben ist genau das Gegenteil von Kontrolle.
Zum Weiterlesen:
- Lucia Moiné: An der Schwelle des Todes – Unheimliche Erlebnisse in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Independently published 2021, 245 Seiten, 15 € (7,99 € Kindle-Ausgabe)
- Roland Schulz: So sterben wir. Piper 2018, 240 Seiten, 11 €
- „Deathbed phenomena“ bei Wikipedia
- Deathbed phenomena: its role in peaceful death and terminal restlessness, Am J Hosp Palliat Care 2010 Mar;27(2):127-33
- Nationwide Japanese Survey About Deathbed Visions: „My Deceased Mother Took Me to Heaven“, jpsm am 19. September 2016
- Going into the light, Irish Times am 22. März 2011
- Sterbebettphänomen, Spiritual Care Band 7, Heft 2 (2017)
- Oscar, der hellsichtige Todeskater, GWUP-Blog am 19. Februar 2010
- „Neue Augenzeugenberichte unheimlicher Phänomene” mit GWUP-Interview, GWUP-Blog am 28. November 2015
- Sonderbare Erfahrungen an unheimlichen Orten: Spuk? GWUP-Blog am 10. Juni 2015
- Wolfgang Hell: Von Schafen und Ziegen – Der sechste Sinn und die unbewusste Wahrnehmung, Skeptiker 2/2010
- Die Phänomenjäger: Interview mit Lucia Moiné, Skeptiker 1/2015
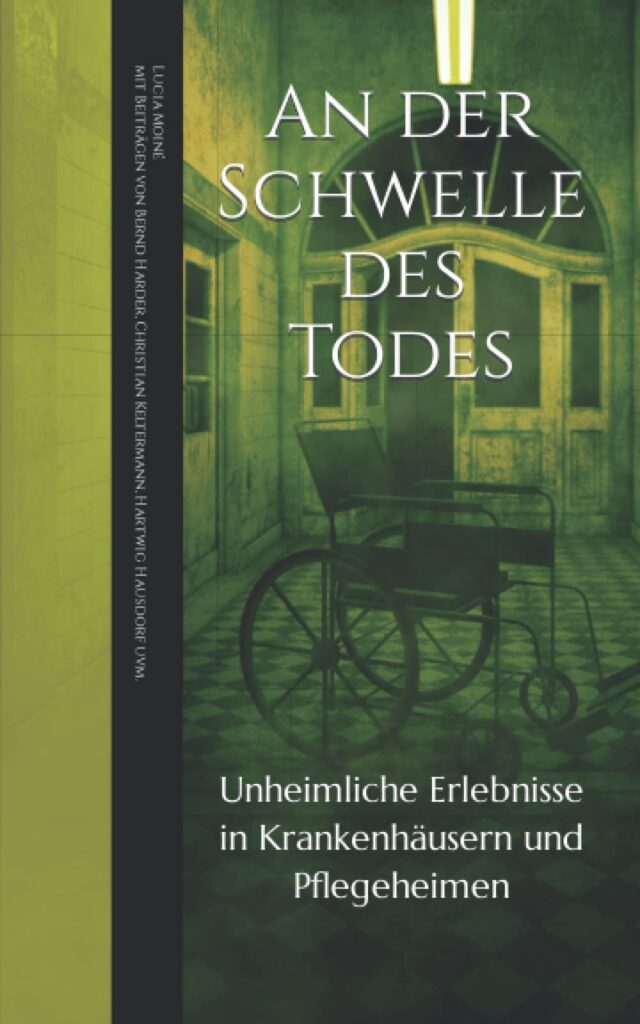
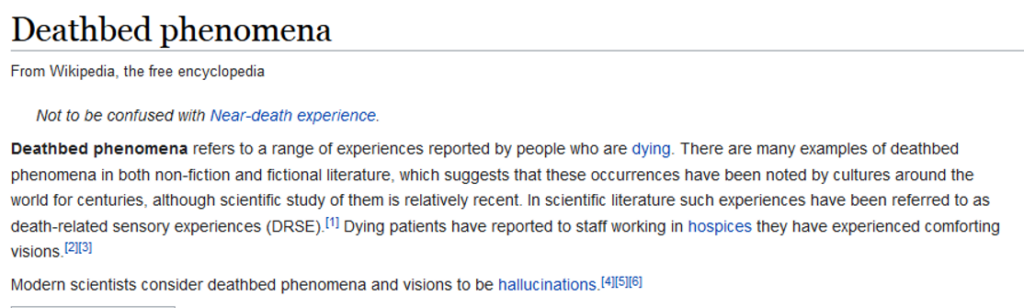

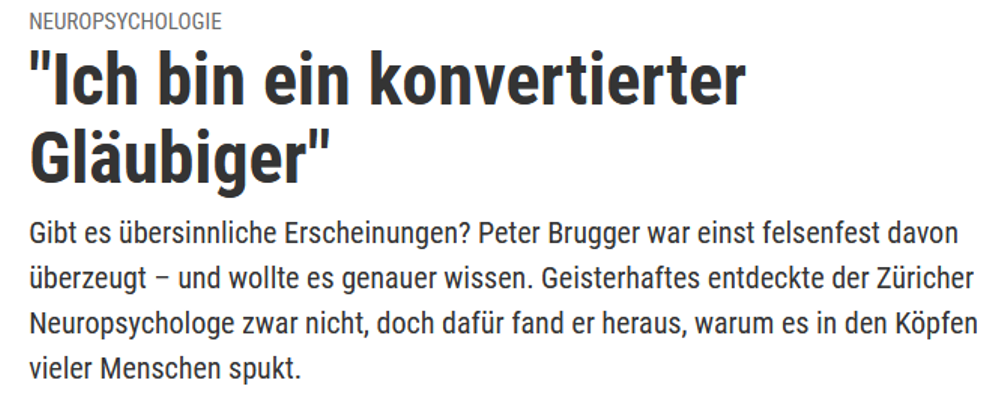

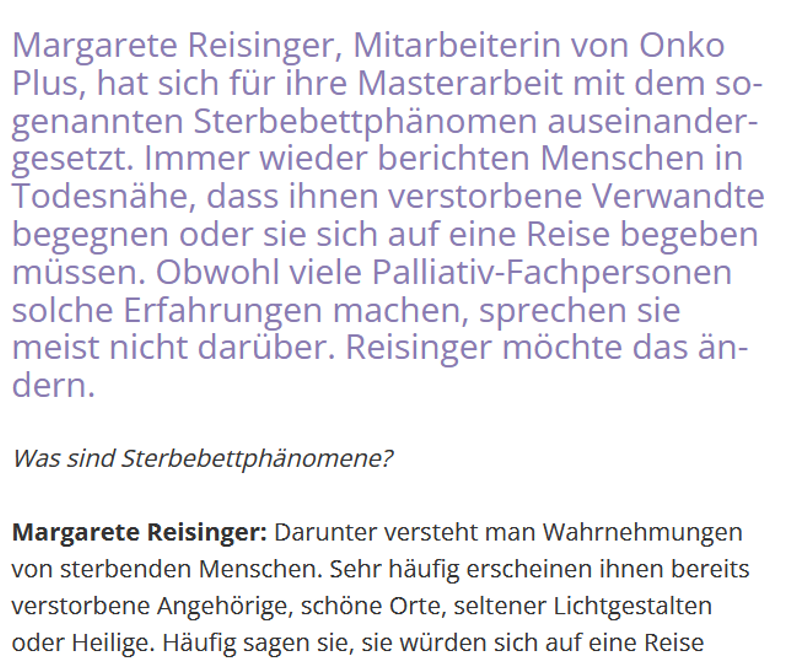
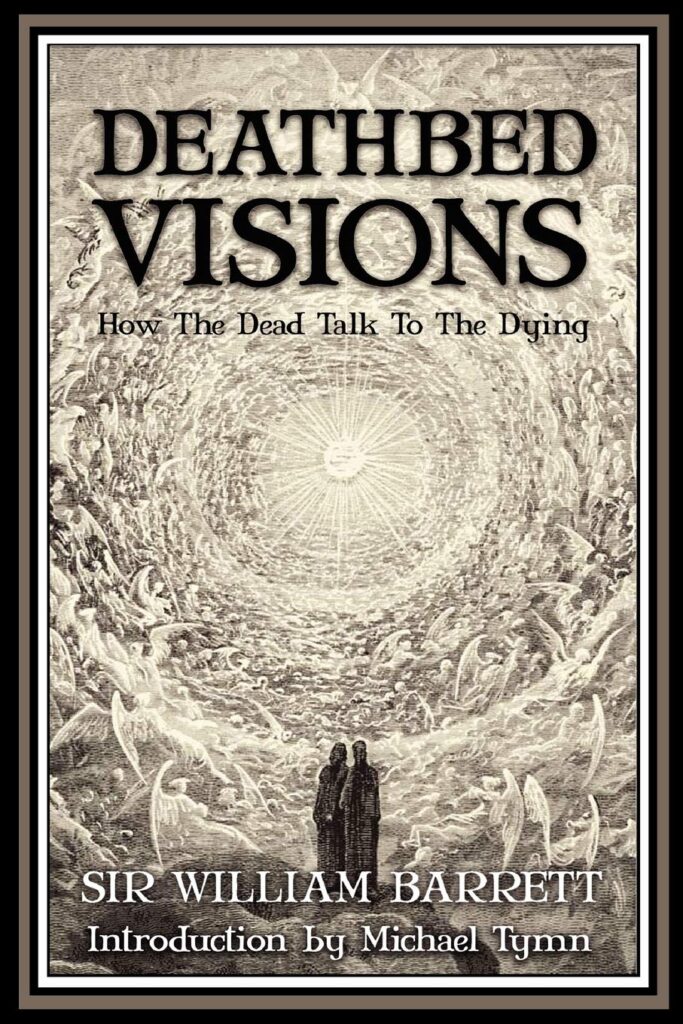

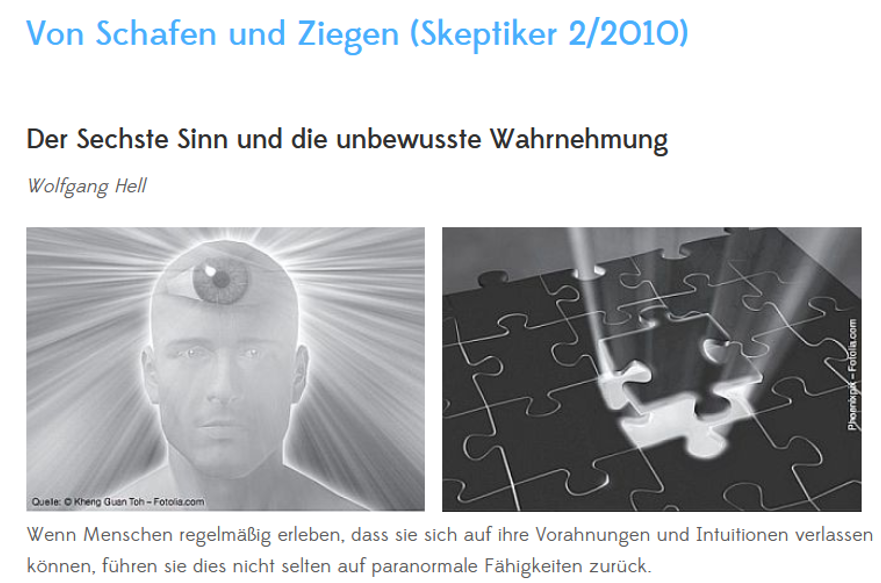

1. November 2021 um 09:58
Ein Freund von mir hatte mich auf ein interessantes Phänomen aufmerksam gemacht.
So tritt es wohl auf, dass Sterbende die Arme Richtung Himmel strecken, was für Außenstehende so wirkt als ob sie eine Art Vision hätten. Er meinte das sei auf Luftnot und den Versuch besser atmen zu können zurückzuführen.
1. November 2021 um 10:13
Danke, sehr interessant.
Ergänzen möchte ich noch, dass da mit Sicherheit auch Reporting Bias (oder vielleicht gibt es sogar einen speziellen, dessen Name mir aber unbekannt ist) eine bedeutende Rolle spielt.
Leute sterben ständig. Bestimmt bleibt auch mal bei einem just in Moment des Sterbens die Uhr stehen. Das ist außergewöhnlich, irgendwie unheimlich und wird erzählt.
Ebenso, wenn der tatsächlich eingetretene Tod von jemandem ebenfalls geträumt wurde.
Auch, wenn ein Gegenstand viele Kilometer entfernt zu Bruch geht, während am anderen Ort jemand stirbt.
Was nicht erwähnenswert ist, ist, wenn jemand stirbt und nichts besonderes passiert – oder aber etwas Ungewöhnliches passiert, von dem niemand was mitbekommt.
1. November 2021 um 12:23
Leute sterben ständig. Bestimmt bleibt auch mal bei einem just in Moment des Sterbens die Uhr stehen. Das ist außergewöhnlich, irgendwie unheimlich und wird erzählt.
Der Kauz galt jahrhundertelang als „Totenvogel“, weil sein charakteristischer Ruf gehört wurde, wenn Verwandte und Freunde sich an den Betten Sterbender versammelten und wache hielten. Dabei war es das Licht der Kerzen und Lampen, welche Insekten anlocken, denen wiederum der Waldkauz nachstellt.
https://www.planet-wissen.de/natur/voegel/eulen/pwiederwaldkauz100.html
Die Sterbbettphänomene sind also nichts Neuzeitiges.
1. November 2021 um 13:38
Meiner Meinung nach muss man bestimmte Phänomene immer im Kontext ihres Nutzens sehen.
Ich selbst bin ein sehr rationaler Mensch, halte es sogar für das oberste Gebot seine Entscheidung wann immer es geht auf Basis rationaler Entscheidungen zu treffen. Auf Basis von Fakten die eindeutig sind und reproduzierbar. Gemessen an kant’schen Konzepten der Ethik.
In jüngeren Jahren habe ich sogar mit einer gewissen Arroganz auf Menschen herabgeschaut, die nicht so denken und handeln.
Wenn man eine Zeit gelebt hat, wenn man diesen grössten und endgültigste Kontrollverlust des Sterbens bei geliebte Menschen ein paar mal miterlebt hat, dann treibt einem das Leben diese Arroganz aus. Man lernt eine Demut. Keine Demütigung, sondern eine Demut der Empathie. Diese letzte Grenze, dieses Ende der eigenen Existenz, überfordert uns, und alles Wissen und Erlernte in uns.
Morphium ist ein Rauschgift, es macht schwer abhängig und hat starke Nebenwirkungen. Trotzdem gibt man es einem schwer kranken oder sterbenden Menschen, um seinen Schmerz zu lindern. Niemand wäre so grausam es ihm zu verweigern oder ihm ein Gegengift zu spritzen das die Wirkung aufhebt.
Deswegen darf sich diese letzte Erfahrung auch der Wissenschaft entziehen. Sie muss nicht geklärt werden und sie sollte auch nicht – des reinen Wissens wegen – zerstört werden.
Wir alle werden irgendwann an einen Abgrund geraten. Einen Abgrund des Unwissens und der Angst. Alles was hilft diesen Abgrund – wenn auch nur scheinbar – zu überbrücken ist legitim
1. November 2021 um 20:12
Tobias
Sie meinen also kurzgefasst, mehr Wissen wäre schädlich, dafür Unwissen, Spekulation, Ahnen, Unsicherheit wäre die bessere Option für diese Situation?
Nicht-Erforschen was da in verschiedenen Zusammenhängen passiert (und evtl diese Vorgänge erklärt und transparent(er) macht)?
Wieso? Kapier ich nicht.